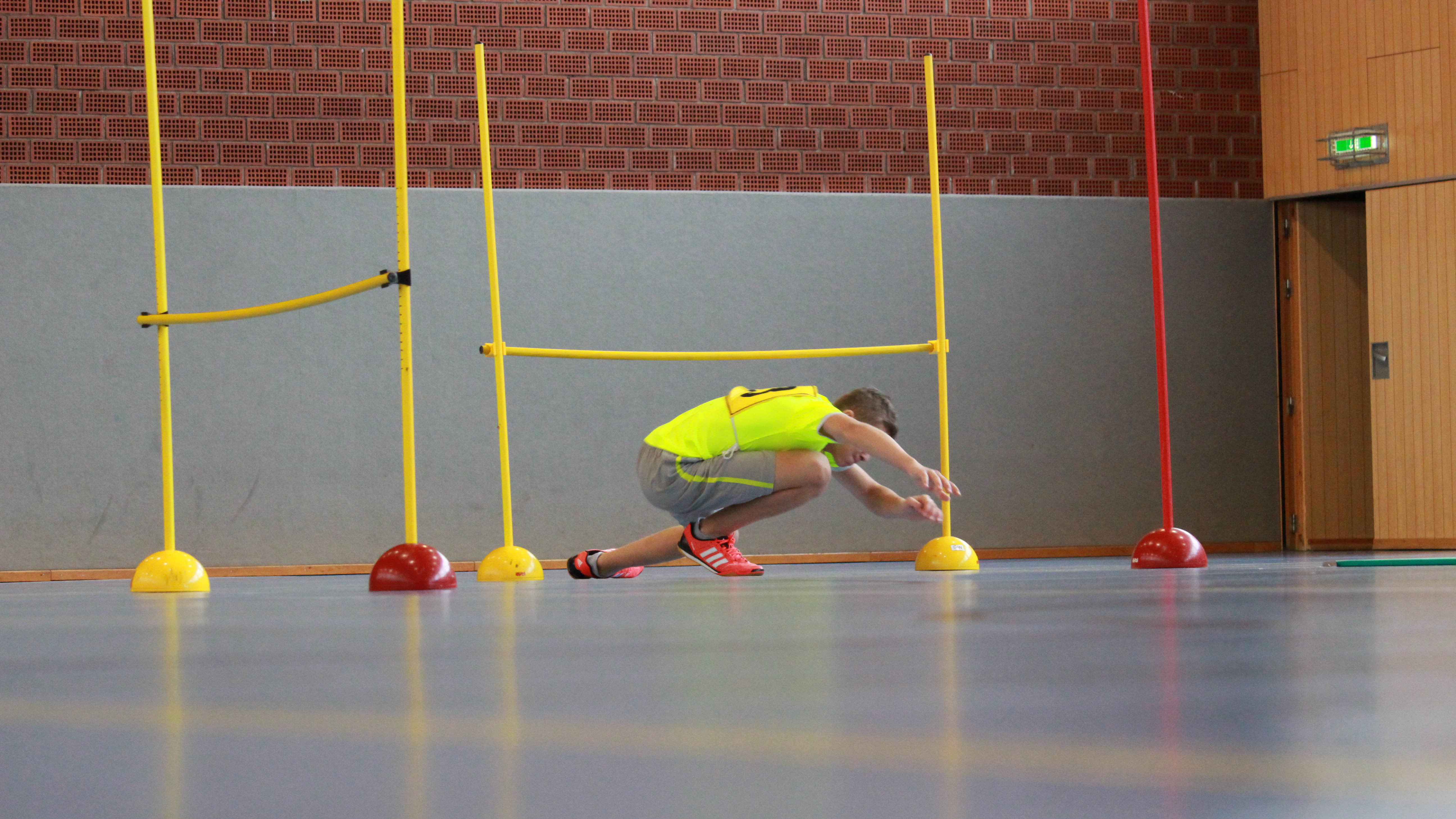Das Olympiazentrum Tirol hat im vergangenen Advent auf das „Wichteln“ verzichtet, stattdessen Spenden gesammelt und einen Charityverkauf von Trainingsbekleidung organisiert. Vor kurzem wurde eine Bungee-Schaukel vom sportlichen Leiter, Christian Raschner (l.), ÖSV-Skiläuferin Stephanie Venier stellvertretend für alle Athletinnen und Athleten und Trainer Christoph Ebenbichler (r.) überreicht. Elisabethinum-Leiter Klaus Springer und Lea freuen sich sehr darüber.
Das Elisabethinum in Axams/Tirol ist eine Einrichtung für junge und ganz junge Menschen mit und ohne Behinderungen. Zum Angebot gehören Kindergarten, ganztägige Schule, Tagesbetreuung und Wohnbereich, Therapie und Arbeitstrainingslehrgang. Derzeit nehmen 117 Kinder und Jugendliche die Angebote des Elisabethinums in unterschiedlichem Ausmaß in Anspruch. 57 Kinder und Jugendliche besuchen die ganztägige Schulform ohne Übernachtung, 22 Kinder und Jugendliche nehmen das Schulzeitinternat in Anspruch, 13 Kinder und Jugendliche leben ganzjährig im Elisabethinum.
Weiter Infos zum Elisabethinum finden Sie HIER.